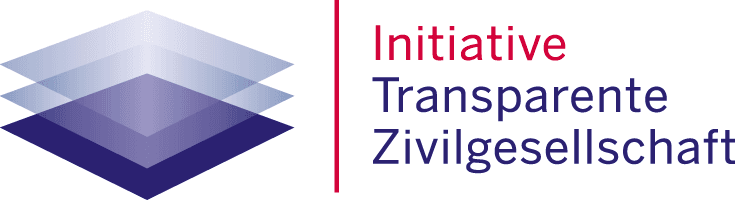Wie gestern bekannt wurde, haben sich Union und SPD auf Eckpunkte für eine Karenzzeit-Regelung geeinigt. Demnach sollen Minister und parlamentarische Staatssekretäre künftig nur dann in Tätigkeiten in Unternehmen und Verbänden wechseln dürfen, wenn „ein Interessenkonflikt ausgeschlossen“ werden könne. Dies gelte für einen Zeitraum von zwölf Monaten, in Einzelfällen auch für 18 Monate. Ob ein Interessenkonflikt vorliegt, soll das Bundeskabinett entscheiden, allerdings unter Berücksichtung des Ratschlags eines Gremiums aus „anerkannten Persönlichkeiten“.

Im März forderten wir vor dem Bundeskanzleramt die Einführung von Karenzzeiten. Bild: Jakob Huber/LobbyControl Alle Rechte vorbehalten
Wir freuen uns, dass die Bundesregierung endlich einen Vorschlag vorgelegt hat. Das war überfällig und dafür haben wir uns mit unserer Kampagne „Keine Lobbyjobs für (Ex)-Politiker“ eingesetzt. Aber die vorliegenden Eckpunkte sind zu schwach. Aus unserer Sicht sind wesentliche Nachbesserungen nötig, damit die Karenzzeit wirksam umgesetzt werden kann.
Keine Wechsel in Lobbyjobs
Der wichtigste Punkt ist, dass die neue Regelung Wechsel in Lobbytätigkeiten während der Karenzzeit nicht grundsätzlich ausschließt. Wechsel in Lobbytätigkeiten sollten unabhängig vom vorherigen Verantwortungsbereich des Seitenwechslers nicht möglich sein. Minister und Staatssekretäre sind auch außerhalb ihres Ressorts an Entscheidungen und Informationsflüssen beteiligt und verfügen über ein breites politisches Netzwerk. Unternehmen heuern ehemaligen Politiker gerne als Türöffner an. Daher braucht es eine Karenzzeit auch für Wechsel in Lobbytätigkeiten, bei denen keine direkte thematische Überschneidung zum bisherigen Amt besteht.
Wenn etwa ein ehemaliger Minister oder Staatssekretär eine eigene Lobbyagentur gründet oder von einer solchen angeheuert wird, besteht kein unmittelbarer und direkter Zusammenhang mit einem konkreten politischen Bereich. Daher sollte der Karenzzeit-Regelung nicht ein zu enger Begriff von Interessenkonflikten zugrunde liegen. Wechsel in Lobbytätigkeiten bei Unternehmen und Verbänden verschaffen finanzstarken Lobbyakteuren Vorteile gegenüber anderen Interessen und sind deshalb für die Demokratie problematisch.
Transparente Verfahren
Außerdem ist wichtig, dass das geplante beratende Gremium bei der Bewertung von Seitenwechseln transparent arbeitet und die Empfehlungen samt Begründung veröffentlicht werden. Das Bundeskabinett darf nicht allein und hinter verschlossenen Türen entscheiden, ob bei einem Seitenwechsel ein Interessenkonflikt vorliegt oder nicht. Insbesondere, wenn der neuen Tätigkeit zugestimmt wird, sollte der Ratschlag des Gremiums samt Begründung veröffentlich werden. Nur so kann eine öffentliche Kontrolle sichergestellt werden.
Beamtete Staatssekretäre wechseln ebenfalls oft
Eine wirksame Karenzzeitregelung sollte zudem auch für politische Beamte gelten. Gerade in den letzten Wochen und Monaten konnten wir beobachten wie Staatssekretäre aus den Ministeriumsspitzen in Lobbyjobs wechselten. So wechselte beispielsweise Thomas Ilka aus dem Gesundheitsministerium zum Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und Birgit Grundmann aus dem Justizressort zur Allianz. Eine Prüfung auf Interessenkonflikte fand hier offenbar nicht statt, obwohl das Bundesbeamtengesetz zumindest die Prüfung, ob durch den Wechsel „dienstliche Interessen“ gefährdet werden, ermöglicht. Offensichtlich reicht diese Regelung nicht aus und kann zudem durch den Verzicht auf Versorungsbezüge leicht umgangen werden. Für politische Beamte sollte die Bundesregierung daher ebenfalls Regeln einführen, die sich an denen für Minister und parlamentarische Staatssekretäre orientieren.
Länge der Karenzzeit nicht ausreichend
Aktuell stehen zwölf bis 18 Monate für die Karenzzeit im Raum. Für welche Fälle 18 Monate gelten sollen, ist bisher noch unklar. Beides ist jedoch nicht ausreichend für eine echte Abkühlphase. Für EU-Kommissare gelten 18 Monate und Beamte müssen mindestens drei Jahre die Aufnahme neuer Jobs anzeigen (§ 105 BBG). Das Übergangsgeld wird bis zu zwei Jahre lang gezahlt und ist bisher mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Das ist die Latte, an der sich die Koalition orientieren sollte. Wir fordern eine Karenzzeit von drei Jahren, da politische Prozesse oft nach 12 oder 18 Monaten nicht abgeschlossen sind und das Kontaktnetzwerk nicht ausreichend abgekühlt ist.
Hamburg führt Karenzzeit von 2 Jahren ein
Dem Bund zuvorgekommen ist unterdessen das Land Hamburg. Bereits vor zwei Wochen einigten sich dort in einer bemerkenswerten Konstellation die Fraktionen von SPD, CDU, Gründen und Linken auf einen Kompromiss. Demnach müssen ehemalige Mitglieder des Hamburger Senats zwei Jahre lang die Aufnahme von Jobs in der Privatwirtschaft anzeigen. Liegen Interessenkonflikte vor, kann die neue Tätigkeit untersagt werden.
Weitere Bundesländer, zum Beispiel Schleswig-Holstein, haben angekündigt, ebenfalls Karenzzeiten einzuführen und sich dabei an der sich im Bund abzeichnenden Regelung orientieren zu wollen. In Schleswig-Holstein sorgte der kürzlich der überraschende Seitenwechsel des Innen- und Wohnungsbauministers Breitner für Diskussionen. Breitner trat aus „privaten Gründen“ von seinem Amt zurück und wird zum Mai nächsten Jahres Direktor beim Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Dieser Fall zeigt exemplarisch, dass auch in den Bundesländern Karenzzeiten dringend nötig sind. Die Regelung auf Bundesebene ist dabei als Orientierung wichtig.
Wir werden uns deshalb in den kommenden Wochen für Nachbesserungen einsetzen und die weitere Debatte zur Ausgestaltung der Karenzzeit genau begleiten. Die nächste Etappe ist bereits morgen: Am Donnerstag wird das Thema Karenzzeiten auf Initiative der Grünen und Linken im Bundestagsplenum diskutiert.
Weitere Informationen:
Bild: Janwikifoto, CC BY-SA 3.0
Bleiben Sie informiert über Lobbyismus.
Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.
Datenschutzhinweis: Wir verarbeiten Ihre Daten auf der Grundlage der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Art. 6 Abs. 1). Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Zur Datenschutzerklärung.