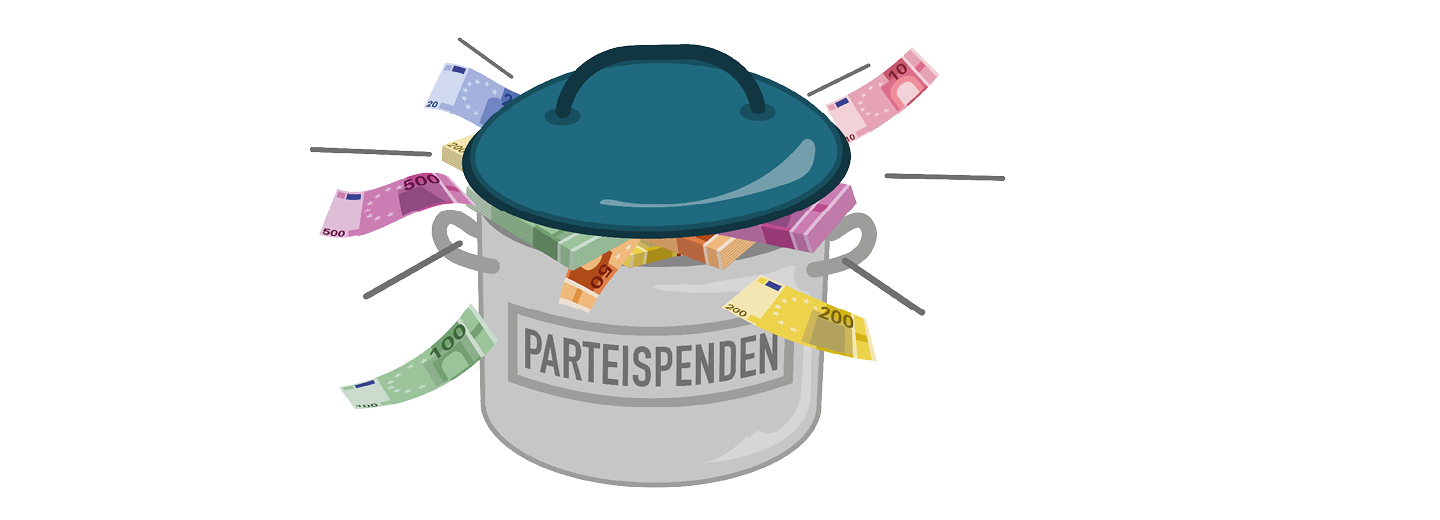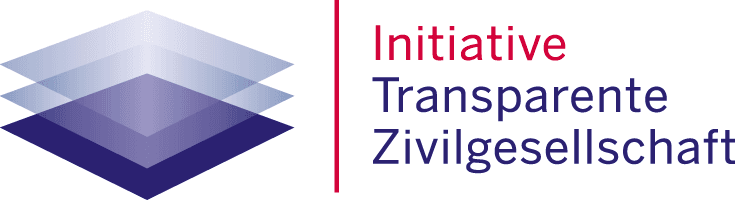Bei der Klage der Partei „Die Partei“ gegen die Verwaltung des Bundestages ging es um den Verdacht, dass eine Parteispende von Christoph Gröner an die CDU an eine politische Forderung geknüpft wurde. Das Urteil wird dennoch die Kontrolle der Parteispenden in Zukunft verbessern. Gleichzeitig zeigen Urteil und Prozess: Ohne bessere Parteispendenregeln ist die Politik nicht vor Käuflichkeit geschützt.
Zusammenfassung
- 2020 spendete der Immobilienunternehmer Christoph Gröner 800.000 Euro an die Berliner CDU. Danach sagten sowohl er als auch der heutige Regierende Bürgermeister Kai Wegner in Interviews, die Spende sei mit politischen Erwartungen verknüpft gewesen. Damit wäre sie illegal.
- Trotz dieser öffentlichen Aussagen erklärte die Bundestagsverwaltung die Spenden für unbedenklich. Ein von uns beauftragtes Rechtsgutachten kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die Begründung, mit der die Verwaltung ihre Prüfung einstellte, rechtswidrig sei.
- Daraufhin forderte LobbyControl, gemeinsam mit WeAct und 70.000 Unterstützer*innen, die Parteien in Deutschland zur Klage auf. „Die Partei“ reichte daraufhin Klage am Verwaltungsgericht Berlin gegen die Bundestagsverwaltung ein.
- Das Gericht folgte unserem Gutachten und erklärte die Begründung der Bundestagsverwaltung, warum sie die Spende als unbedenklich einstufte, für rechtswidrig. Es stellte zudem klar, dass andere Parteien benachteiligt werden, wenn die Bundestagsverwaltung illegale Parteispenden nicht sanktioniert. Der Klageweg für Parteien über das Drittklagerecht steht in Zukunft also offen. Das könnte im Ergebnis die Arbeit der Bundestagsverwaltung verbessern.
- Das Gericht glaubte allerdings dem als Zeugen geladenen Spender Christoph Gröner, dass er in den Interviews gelogen habe, und wies die Klage ab. Das zeigt vor allem, wie schwierig es ist, im Nachhinein eine Erwartungsspende zu beweisen. Insgesamt ist das Urteil ein katastrophales Signal für die Integrität unserer Demokratie.
- Das Verfahren legte darüber hinaus an vielen Stellen offen, dass die Bundestagsverwaltung überhaupt nicht in der Lage ist, Erwartungsspenden wirklich zu verhindern oder nachzuweisen. Ohne eine Reform gibt es deshalb in Deutschland keinen ausreichenden Schutz vor der Käuflichkeit von Politik.

Doch nur gelogen – das Gericht glaubt Gröner
Das Verwaltungsgericht Berlin hat die Klage der Partei „Die Partei“ gegen die Bundestagsverwaltung als unbegründet abgewiesen. Das Gericht folgte letztlich der Darstellung des als Zeugen geladenen Spenders Christoph Gröner, dass seine in Interviews geäußerten Erwartungen Lügen gewesen seien und die Spenden der allgemeinen Förderung bürgerlicher Politik dienten. Damit gäbe es keine Anhaltspunkte für eine Erwartungsspende.
Gleichzeitig wurde mit dem Urteil jedoch klargestellt, dass andere Parteien vor Gericht gegen die Bundestagsverwaltung vorgehen können, wenn diese Spenden an konkurrierende Parteien nicht ausreichend kontrolliert und sanktioniert. Da es das erste Verfahren überhaupt in einer solchen Konstellation war, hat das Urteil richtungsweisende Bedeutung und stellt wichtige Weichen für die Zukunft.
Die Bundestagsverwaltung wird effektiv der Kontrolle durch andere Parteien und die Gerichte unterstellt. Sie wird ihre vorhandenen Prüfmöglichkeiten zukünftig wohl mehr ausschöpfen müssen. Parteien steht damit in Zukunft offen, gegen fragwürdige Entscheidungen der Bundestagsverwaltung gerichtlich vorzugehen, auch wenn sie selbst nicht direkt beteiligt sind.
An Erwartungen geknüpfte Parteispenden sind illegal
Zudem bekräftigte das Gericht die Rechtsauffassung, dass eine Parteispende bereits dann als illegal einzustufen ist, wenn mit ihr konkrete Erwartungen eines politischen oder wirtschaftlichen Vorteils kommuniziert werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Partei eine entsprechende Handlung tatsächlich ergreift. Diese Klarstellung ist ein wichtiges Signal, denn die Bundestagsverwaltung hatte zuvor anders argumentiert.
Gleichzeitig zeigt das Verfahren auch auf, dass wir in Deutschland nicht vor Käuflichkeit der Politik geschützt sind. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass der Tatbestand der Erwartungsspende sich im Nachhinein kaum nachweisen lässt. Auch die Klärung vor Gericht wirkt unbefriedigend und lässt einige Fragen offen.
Zudem hatte die Bundestagsverwaltung im Verfahren wiederholt betont, dass ihr die nötigen Ermittlungsbefugnisse fehlen, um Erwartungsspenden wirklich zu kontrollieren und aufzuklären. Da es in Deutschland, anders als in den meisten EU-Staaten, auch keine Obergrenze für Parteispenden gibt, lässt sich so nicht ausschließen, dass mit hohen Parteispenden politische Gefälligkeiten erkauft werden. Hier besteht dringender Reformbedarf.

Der Fall: 800.000 Euro und Interviews
Die Spenden Gröners gerieten jedoch nicht nur wegen ihrer Höhe in die Kritik. 2021 gaben sowohl Christoph Gröner als auch der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner (damals Spitzenkandidat und heute Regierender Bürgermeister) in Interviews an, dass die Spende an konkrete Forderungen geknüpft gewesen sei. In einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur am 8.5.2021 sagte Gröner:
Ich habe der CDU drei Bedingungen gesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass die Kinder im Kinderheim, die behindert sind, genauso viel Geld für ihre Kleider kriegen wie die nichtbehinderten. Die kriegen nämlich 200 Euro weniger. Ich habe gesagt: Wenn das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel nicht abschafft, dann möchte ich auch, dass die CDU den nicht abschafft, aber modifiziert. Ich habe noch eine dritte Forderung damit verbunden. Da ging es ein bisschen auch wieder um Kinderheime. Ich wollte gerne in Zukunft sicherstellen, dass wir dort eine Kommunikationsebene aufbauen, weil wir zweieinhalbtausend Kinder in Berlin unterstützen. […]“
In einem Interview mit Jung & Naiv am 10.08.2021 erklärte Kai Wegner zu den Spenden von Christoph Gröner:
Er hat einen Wunsch geäußert. Er hat zu mir gesagt: Herr Wegner, bitte tun Sie alles dafür, dass es nicht so viele Obdachlose in der Stadt gibt.“
Knapp zwei Jahre nach seiner ersten Äußerung wiederholte Gröner in einem Podcast des Tagesspiegel vom 12.5.2023:
Ich habe eine einzige Forderung an den Herrn Wegner gestellt, und die war die, dass ich gesagt habe: ‘Kinder im Kinderheim, die behindert sind, sollen bitte in Zukunft den gleichen Kleidersatz kriegen wie Kinder, die nicht behindert sind.’ Da wir sehr viele Kinder in Berlin betreuen, über zweieinhalbtausend in Kinderheimen, habe ich mir erlaubt, eine solche Forderung in den Raum zu stellen. Der werde ich auch konsequent nachgehen, das erwarte ich. Ich werde es prüfen. Ich bin davon überzeugt, dass er das ganz von allein auch weiß. Das ist sozusagen schriftlich fixiert.“
Das Problem an den Äußerungen: Sollte Gröner wirklich konkrete politische Erwartungen geäußert haben, dann hätte die CDU diese Spende nicht annehmen dürfen, da es sich um eine Einflussspende nach dem Parteiengesetz (§ 25 Absatz 7) handeln würde.
Demzufolge sind Spenden unzulässig, wenn sie „der Partei erkennbar in Erwartung eines wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewährt werden.“ Wird eine solche Spende dennoch angenommen und im Rechenschaftsbericht der Partei geführt, kann die Bundestagsverwaltung eine Sanktion in der dreifachen Spendenhöhe verhängen, in diesem Fall also 2,4 Millionen Euro.
Zwar unterschieden sich Wegner und Gröner in ihrer Darstellung, was genau die Bedingung gewesen sein soll, allerdings waren sich sowohl Spender als auch der Parteivertreter einig, dass die Spende an Erwartungen geknüpft war. Die Verdachtsmomente für eine Erwartungsspende waren also erheblich.
LobbyControl forderte Untersuchung der Parteispende
Im Mai 2023 forderte LobbyControl die Bundestagsverwaltung deshalb auf, eine Untersuchung der Spende von Gröner einzuleiten. Im Juli 2023 gab die Verwaltung auf Nachfrage von Transparency International jedoch bekannt, dass sie die Untersuchung eingestellt habe. Dies begründete sie unter anderem damit, dass der Tatbestand einer Einflussspende erst vorläge, wenn „eine Spendenzahlung erkennbar in einer so gearteten Kausalbeziehung mit einer von einer Partei getroffenen oder von ihr zu treffenden Entscheidung steht, dass diese Entscheidung der Partei ohne die Spendenleistung nicht oder nicht in dieser Weise getroffen würde oder getroffen worden wäre.“
Diese Rechtsauslegung der Bundestagsverwaltung war jedoch mehr als zweifelhaft. An keiner Stelle im Parteiengesetz ist die Rede davon, dass ein Kausalzusammenhang zwischen Spende und den politischen Entscheidungen einer Partei nachweisbar sein muss, damit der Tatbestand der Einflussspende erfüllt ist. Ganz im Gegenteil: Das Gesetz legt eindeutig fest, dass Spenden, die „erkennbar in Erwartung eines politischen oder wirtschaftlichen Vorteils gewährt werden“, von Parteien nicht angenommen werden dürfen.
Eine Spende wird also nach dem Gesetz bereits zum Zeitpunkt der Übergabe illegal, wenn der Spender oder die Spenderin dabei eine konkrete Erwartung zum Ausdruck bringt – ganz unabhängig davon, ob die Partei auch tatsächlich danach handelt oder nicht. Dies bestätigte ein von uns in Auftrag gegebenes Gutachten durch die renommierte Parteienrechtlerin Prof. Dr. Sophie Schönberger.
Wer darf gegen die Bundestagsverwaltung klagen?
Die Bundestagsverwaltung ließ sich jedoch nicht von unserem Gutachten beeindrucken und rückte von der Einstufung der Spende als unproblematisch nicht ab. Also blieb nur der Weg einer Klage. Doch anders als im Umwelt- oder Verbraucherschutzbereich gibt es im Bereich Demokratie keine Verbandsklagerechte. Bestimmte Organisationen dürfen daher nicht im Namen der Demokratie, die sich ja nicht selbst vertreten kann, klagen.
Klageberechtigt wären allenfalls andere politische Parteien. Diese stehen im Wettbewerb miteinander. Wird eine möglicherweise illegale Spende an eine Partei nicht verfolgt und sanktioniert, entstehen allen anderen Parteien Nachteile. Ob aber andere Parteien tatsächlich klagen dürfen, wenn es um das Handeln der Verwaltung gegenüber einer anderen Partei geht, war rechtlich nicht eindeutig. In der Bundesrepublik hat noch nie eine Partei die Verwaltung in so einer Angelegenheit verklagt.
Trotz dieser Unsicherheiten forderten wir die Parteien in Deutschland auf, den Klageweg zu beschreiten, denn wenn an konkrete Erwartungen geknüpfte Parteispenden nicht verfolgt werden, wird Politik käuflich. Über 70.000 Menschen unterstützen diese Forderung in einer Petition, die wir gemeinsam mit WeAct starteten. Auf unsere Aufforderung reagierte die Kleinpartei „Die Partei“ und reichte im Juni 2024 Klage ein.
Das Verfahren

Der erste Prozesstag: CDU greift Klageberechtigung an
Der erste Prozesstag fand am 22.05.2025 vor dem Verwaltungsgericht Berlin statt. Neben der Bundestagsverwaltung und der Partei „Die Partei“ war die CDU als Beigeladene durch ihren Anwalt vertreten. Vorsitzende des Gerichts war Erna Xalter. Wir demonstrierten vor dem Gericht mit Bannern und Schildern für eine bessere Kontrolle der Parteispenden und für einen Parteispendendeckel.
Während die Bundestagsverwaltung versuchte, ihren Beschluss zu verteidigen, zielte die CDU darauf ab, die Klageberechtigung der „Partei“ anzugreifen. Als Kleinpartei entstünde bei ihr nur ein Schaden in einem niedrigen zweistelligen Betrag, so der Anwalt der CDU, da nur die Auswirkungen der Spende auf die Verteilung der staatlichen Parteienfinanzierung anzurechnen seien. Entsprechend sei die Klage dann unverhältnismäßig.
Beides überzeugte die Richterin jedoch nicht. Zunächst erteilte sie der Rechtsauslegung der Bundestagsverwaltung, mit der sie die Untersuchung der Spende eingestellt hatte, eine klare Absage. Damit folgte sie der Argumentation des von uns beauftragten Rechtsgutachtens.
Auch die Argumentation der CDU wies sie klar zurück. In der Begründung für den Beweisbeschluss, einer Art Zwischenurteil am Ende des Prozesstages, stellte sie klar, dass die Klage der „Partei“ berechtigt sei. Wenn die Bundestagsverwaltung eine illegale Spende nicht sanktioniere, käme dies einer staatlichen Zuwendung gleich. Da Parteien im politischen Wettbewerb stehen, würden andere Parteien durch eine solche Zuwendung benachteiligt und können auf Basis der Chancengleichheit der Parteien (Art. 21 Abs.1 des Grundgesetzes) gegen die Entscheidung vorgehen.
Paradigmenwechsel bei der Kontrolle von Parteispenden: Drittklagerecht
Diese Klarstellung ist ein riesiger Schritt für die Aufsicht von Parteispenden. Die Bundestagsverwaltung ist nicht gerade mit intensiver Prüfung und Kontrolle im Bereich Parteispenden aufgefallen, wie auch der Gröner-Fall zeigt. Das liegt zwar auch daran, dass ihr notwendige Ermittlungsbefugnisse fehlen, aber auch die bestehenden Möglichkeiten schöpft sie meist nicht aus.

Das dürfte sich jetzt ändern, da die Bundestagsverwaltung damit rechnen muss, vor Gericht zur Verantwortung gezogen zu werden. Während der Anwalt der CDU diese Entwicklung im Verfahren als „Öffnen der Büchse der Pandora“ bezeichnete, erwarteten wir uns eine signifikante Verbesserung der Kontrolle von Parteispenden. Auch die Anwältin der „Partei“ und Autorin unseres Rechtsgutachtens, Prof. Sophie Schönberger, betonte die rechtspolitische Bedeutung:
Mit seinem Beweisbeschluss hat das VG Berlin umfassend anerkannt, dass nicht mehr nur die Bundestagsverwaltung, sondern auch konkurrierende Parteien gegen illegale Parteispenden vorgehen können. Das ist ein Paradigmenwechsel, der einen großen Gewinn für die effektive Kontrolle solcher Spenden darstellt.“
Ob es sich bei der Gröner-Spende um eine illegale Erwartungsspende handelte, befand Richterin Erna Xalter für noch nicht „entscheidungsreif“. Mit einem sogenannten „Beweisbeschluss“ ordnete sie die Vernehmung von Christoph Gröner für einen zweiten Prozesstag an.
Der zweite Prozesstag: glaubhaft „geschwindelt“
Erst vier Monate später fand der zweite Prozesstag statt, bei dem Christoph Gröner am 29.09.2025 als Zeuge aussagte. Der 57-Jährige erzählte vor Gericht eine gänzlich andere Geschichte, wie es zu den Spenden gekommen sei. Die Spenden seien erstmals 2019 in einem größeren Treffen angebahnt worden. Die einzige Motivation sei es gewesen, eine bürgerliche Partei in Berlin zu stärken.
Nicht erinnern konnte Gröner sich, ob Kai Wegner bei dem Treffen dabei gewesen war. Mit Kai Wegner, den Gröner zuvor mehrfach als Freund bezeichnet hatte, habe es keine Einzelgespräche vor den Spenden gegeben und eigentlich habe Gröner Wegner in seinem Leben auch nur fünf bis sechsmal getroffen.
Bei seinen anderslautenden Aussagen in Interviews habe er, Christoph Gröner, gelogen (oder, wie der CDU-Anwalt es ausdrückt, „geschwindelt“):
Man wird freundlich eingeladen, aber dann gerät man doch immer unter den Generalverdacht. Der Generalverdacht ist, dass wir als Unternehmer unser Geld in Geldsäcken nach Hause bringen und uns über die Gesellschaft nicht scheren. Da werden fast Klassenkampftheorien aufgestellt, da wird einem die Luft abgeschnitten, zu einem lauteren Kaufmann, der ein bisschen über den Tellerrand rausschaut. Und ich versuche dann entsprechend gegenzuhalten. Ich habe dort gesagt: ‚Ich habe eine einzige Forderung.....‘ Es hätte aber heißen müssen: ‚Ich hätte gerne eine einzige Forderung gestellt.‘“
Auf die Frage, warum er eine so ehrenrührige Lüge erzählte, um dem Generalvorwurf zu begegnen, wo die Wahrheit doch deutlich weniger belastend gewesen sei, konnte Gröner allerdings keine wirklich schlüssige Antwort geben.
Gericht glaubt Gröner, gelogen zu haben
Allerdings überzeugte Gröners Darstellung das Gericht. Die Klage der „Partei“ wurde abgewiesen und die Spende für zulässig erklärt. In der entsprechenden Pressemitteilung des Verwaltungsgerichtes heißt es dazu:
Nach der Beweisaufnahme durch Vernehmung des Spenders als Zeugen habe sich die Kammer nicht davon überzeugen können, dass Herr Gröner im maßgeblichen Zeitpunkt der Spendenleistung eine konkrete Erwartung gegenüber einer spendenannahmeberechtigten Person der Berliner CDU geäußert habe. Herr Gröner habe vielmehr nachvollziehbar dargelegt, dass seine Spendenmotivation darin bestanden habe, die bürgerliche Mitte und den Wahlkampf der CDU zu stärken. Er habe glaubhaft eingeräumt, in den medialen Äußerungen zu seinen Spenden gelogen zu haben. Bei dieser Sachlage sah die Kammer keine Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Spendenannahme.“
Die Bundestagsverwaltung hat also gewonnen. Ungeschulten Betrachter*innen hätte das jedoch entgehen können, denn die Vertreter*innen der Bundestagsverwaltung schienen äußerst unzufrieden mit dem Urteil. Und das mit Grund: Die Drittklageberechtigung, die das Gericht mit diesem Urteil bestätigt hat, wird große Auswirkungen auf Ihre Arbeit haben. In Zukunft kann die Bundestagsverwaltung für Fehlentscheidungen oder mangelnde Prüfung von anderen Parteien vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden.
Noch vor Urteilsverkündung versuchte die Bundestagsverwaltung intensiv, die Drittklageberechtigung doch noch zu kippen – aber ohne Erfolg. Als Prozessgewinnerin hat sie auch keine Möglichkeit, das Urteil anzufechten. Deshalb wird die Drittklageberechtigung Bestand haben. Die Zeiten, in denen die Bundestagsverwaltung für ihre Prüfentscheidungen nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnte, sind vorbei.
Was das Urteil bedeutet
Die Aufsicht über die Parteispenden ist eine wichtige demokratische Aufgabe und die Bundestagsverwaltung steht dem politischen Betrieb und den Parteiapparaten sehr nahe. Nicht zuletzt steht an ihrer Spitze die Bundestagspräsidentin, also eine Parteipolitikerin. Deshalb gibt es immer wieder Zweifel daran, ob die Bundestagsverwaltung ausreichend unabhängig ist und ob sie ihre Kontrollmöglichkeiten wirklich ausschöpft. Es ist deshalb das Mindeste, dass andere Parteien vor Gericht Klärung verlangen können.
Auf die Prüftätigkeit der Bundestagsverwaltung wird das Urteil positive Effekte haben und damit die Demokratie stärken. Dass die Verwaltungsgerichte nun mit Klagen bis hin zur Dysfunktionalität überschwemmt werden würden, wie es der Anwalt der CDU prophezeite, ist dennoch unwahrscheinlich. Eine Klage ist mit erheblichen Kosten verbunden und es braucht einen Mindestbestand an Verdachtstatsachen. Diese zusammenzubekommen, ist sicher nicht einfach, da die Transparenz von Parteispenden weiterhin unzureichend ist.
Dass es in diesem Fall überhaupt zu einem Verfahren kommen konnte, lag an einer sehr besonderen Konstellation: Alle Beteiligten sprachen öffentlich über mit der Spende verknüpfte Erwartungen und die Bundestagsverwaltung schickte noch dazu – auskunftsfreudiger als sonst – eine Begründung für die Einstellung ihres Prüfverfahrens mit.
Gröners Lüge ist nicht schlüssig
Gerade weil die Informationslage in diesem Fall so gut war, lässt die gerichtliche Klärung des Sachverhalts einen bitteren Beigeschmack zurück. Wenn man den Aussagen von Christoph Gröner Glauben schenkt, bleibt unerklärlich, wie Kai Wegner zu der Überzeugung gelangen konnte, mit der Spende seien konkrete Erwartungen verbunden gewesen.
Außerdem ist nicht wirklich schlüssig, warum Gröner eine Lüge konstruiert haben soll, um sich gegen Anschuldigungen zu wehren, wenn die Lüge deutlich mehr Grund zur Anschuldigung gibt, als der von ihm geschilderte Spendenablauf.
Dass das Gericht trotz der öffentlichen Aussagen, also einer guten Informationslage, keine ausreichenden Beweise für eine Erwartungsspende sah, verdeutlicht: Der Tatbestand der Erwartungsspende ist reine Augenwischerei. Oder, wie es Heike Merten, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Berliner Zentrums für Parteien- und Parlamentsrecht (BZPP), für den Verfassungsblog zusammenfasst:
Das Verfahren vor dem VG Berlin hat deutlich gezeigt, dass Einflussspenden als verbotene Spenden im Ergebnis kaum nachweisbar sein dürften und damit parteienrechtlich bedeutungslos sind“
Auch die Bundestagsverwaltung betonte im Gerichtsverfahren immer wieder, dass ihr Ermittlungsbefugnisse fehlen, um den Verdacht einer Erwartungsspende wirklich auszuräumen. Tatsächlich hat sie kaum Möglichkeiten, um Beweise sicherzustellen. Die Bundestagsverwaltung kann weder Dokumente beschlagnahmen, Banktransaktionen einsehen, abhören oder verbindliche Zeugenbefragungen durchführen. So hat sie nahezu keine Handhabe, um Schutzbehauptungen als solche zu widerlegen.
Parteispenden-Regeln funktionieren nicht
Das hat weitreichende Folgen. Denn in einer Demokratie können Parteispenden nur unter der Bedingung zulässig sein, wenn sichergestellt ist, dass sich damit keine politischen Gefälligkeiten erkauft werden. In Deutschland – wo im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern Spenden in beliebiger Höhe erlaubt sind – bräuchte es eigentlich extra scharfe Kontrollmechanismen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Für das Vertrauen in die Politik ist das Urteil fatal.
Der ganze Fall zeigt, dass die gegenwärtigen Regeln für Parteispenden so nicht funktionieren und sich Erwartungsspenden in der Praxis kaum verhindern lassen. Es braucht deshalb eine umfassende Reform der Regeln für Parteienfinanzierung. Dazu gehören:
- Eine jährliche Obergrenze von 50.000 Euro pro Geldgeber*in für Parteispenden und Sponsoring.
- Namentliche Offenlegung aller Spenden ab 2.000 Euro in den Rechenschaftberichten und ab 10.000 Euro sofort.
- Eine wirklich unabhängige und angemessen ausgestattete Kontrollinstitution, die Verdachtsfällen aktiv nachgeht und die Durchsetzung der Gesetze gewährleistet.

Parteispenden: Jetzt Deckel drauf!
Spenden für Parteien dürfen in Deutschland beliebig hoch sein. Das ist undemokratisch, da viel Geld viel Einfluss bedeutet. Es muss endlich ein Deckel auf die Parteispenden!
Jetzt Appell unterschreiben!