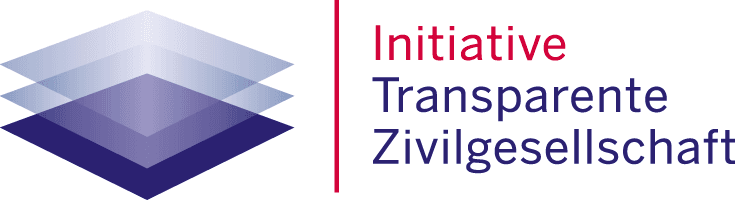Die EU-Kommission hat zu Beginn des Jahres einen Autodialog gestartet, um über die Zukunft der Branche zu sprechen. Das Ergebnis: Die Abgasregeln sollen abgeschwächt werden. Die für 2025 festgelegten Flottengrenzwerte für CO2 müssen nun noch nicht eingehalten werden, die Hersteller sollen mehr Zeit bekommen, bevor sie Strafen zahlen müssen. William Todts, Direktor des Umweltdachverbands T&E (Transport & Environment) hat als Vertreter für Umweltverbände am Autodialog teilgenommen.
William Todts, Sie waren Teil des „Strategischen Dialogs über die Zukunft der Automobilindustrie“ mit der EU-Kommission und vertreten Umweltorganisationen in ganz Europa, die sich für sauberen Verkehr einsetzen. Die anderen rund 20 Teilnehmer:innen, die von der Kommission eingeladen wurden, vertraten jedoch überwiegend die Autoindustrie. Wie haben Sie den Austausch erlebt?
Es macht einen großen Unterschied für die Dynamik eines solchen Treffens, wenn die Zivilgesellschaft im Raum ist, also Umwelt-NGOs und Verbraucheranliegen oder fortschrittliche Industrie. Es ist wichtig, unsere Perspektive einbringen zu können und auch wissenschaftliche und evidenzbasierte Analysen und Forschungen, um ein Gegengewicht zur Industrie zu bilden. Ich denke also, die Kommission hat in dem Punkt gute Arbeit geleistet, uns einzubeziehen. Und zwar trotz der Versuche einiger Vertreter der Industrie, wie z. B. des Verbands der Automobilindustrie (VDA) aus Deutschland, uns aus dem Dialog herauszuhalten.

William Todts, Geschäftsführer von T&E
Der Dachverband für Umweltorganisationen in ganz Europa setzt sich für die Erreichung einer emissionsfreien Mobilität ein. William Todts setzte sich erfolgreich dafür ein, dass die CO2-Emissionen von Lkw in Europa erstmals reguliert wurden. In jüngster Zeit leitete er die Arbeit von T&E zum europäischen Green Deal, den weltweit ehrgeizigsten Klimagesetzen, einschließlich der CO2-Grenzwerte für Autos bis 2035, der Treibstoffvorgaben für die Luftfahrt und der CO2-Bepreisung für den Schiffsverkehr. William Todts ist Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats des Volkswagen-Konzerns, einem unabhängigen Beratungsgremium des Automobilherstellers.
T&E hatte schon vor der Veröffentlichung des Abschlussberichts Bedenken geäußert, wie das Ergebnis aussehen könnte. Was ist Ihre Einschätzung zum„Aktionsplan Auto“, den die Kommission nun veröffentlicht hat? Was wird eine schwächere Regulierung für Verbraucher:innen und die Umwelt bedeuten?
Es bedeutet vor allem, dass es weniger günstige E-Autos im Jahr 2025 gibt. Das Hauptergebnis des Prozesses ist eine Schwächung der Regeln für das Jahr 2025. Die für 2025 festgelegten Flottengrenzwerte für CO2 sollen nun noch nicht eingehalten werden müssen, die Hersteller haben mehr Zeit, es fallen noch keine Strafen für sie an. Als Konsequenz wird die europäische Industrie sich weiterhin stärker auf den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor konzentrieren. Europäische Hersteller werden weniger E-Fahrzeuge produzieren, vor allem weniger erschwingliche E-Autos, als sie das bei drohenden Strafzahlungen getan hätten.
Wir schätzen, dass die europäischen Hersteller zwischen 2025 und 2027 etwa 880.000 weniger E-Fahrzeuge verkaufen werden, davon 190.000 erschwingliche E-Fahrzeuge. Das wird zu zusätzlichen 29 Millionen Tonnen CO2-Emissionen führen, die durch die stattdessen zusätzlich verkauften Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor entstehen. Alles andere wird sich noch zeigen müssen. Aber wir können davon ausgehen, dass die Industrie dadurch, dass die Tür für Zugeständnisse geöffnet wurde, ermutigt wird, mehr zu fordern und die Gesetzgebung weiter zu schwächen.
Welche Rolle spielte die deutsche Autoindustrie in diesem Dialog? Haben Sie Druck für bestimmte Maßnahmen beobachtet?
Die deutschen Automobilhersteller wollen drei Dinge. Erstens: Die Verschiebung des Termins 2025 für die CO2-Flottengrenzwerte um zwei Jahre. Zweitens: Unter dem Deckmantel der Technologieoffenheit wollen sie die Null-Emissions-Vorschriften für 2035 für Plug-in-Hybride, E-Fuels und vielleicht sogar Biokraftstoffe öffnen. Und drittens soll die EU in Handelskonflikten mit den USA und China kapitulieren und die Zölle auf in China hergestellte E-Autos zurücknehmen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für die europäische Industrie zu schaffen.
Technologieoffenheit soll nun auch das Kernstück der Überarbeitung der CO2-Flottengrenzwerte für die nächsten Jahre sein. Das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen letzte Woche angekündigt. Können Sie erläutern, was damit zu erwarten ist?
Das ist ein Codewort dafür, dass Verbrennungsmotoren auch nach 2035 noch erlaubt sind. Theoretisch könnten Biokraftstoffe oder E-Fuels es ermöglichen, dass Autos mit Verbrennungsmotor CO2-neutral sind. In der Praxis ist das zu 99 Prozent unmöglich, so dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Norm für 2035 – also das sogenannte „Verbrenner-Aus“ – deutlich abgeschwächt wird.
Waren E-Fuels in diesem Dialog also auch ein Thema? Die Ausnahme vom Verbrenner-Aus 2035 für E-Fuels war ja bereits ein Erfolg für die Mineralöllobby.
E-Fuels waren nur ein kleiner Teil des Dialogs. Das ist nicht verwunderlich, denn der wichtigste Unterstützer der E-Fuels-Lobby ist die Mineralölindustrie, die die Massen-Elektrifizierung der Autoindustrie verhindern will. E-Fuels sind ein Trick der Mineralölindustrie, um vorzutäuschen, dass Mineralöl sauber sein kann. Die Autoindustrie weiß, dass E-Fuels unsinnig sind, und konzentriert sich daher auf Änderungen, die für sie und ihre Gewinne einen echten Unterschied machen, wie z.B. eine einfache Aufweichung der Gesetze.

Unterstützen Sie uns als Fördermitglied!
Wir decken Missstände auf und setzen einseitigem Lobbyismus Grenzen. Zeigen Sie mit Ihrer Fördermitgliedschaft, dass Sie dabei an unserer Seite stehen.
SpendenViele Jahre lang gab es in Deutschland sogenannte „Autogipfel“ und sowohl in Berlin als auch in Brüssel viele Gespräche zwischen Politik und Autoindustrie, ohne dass die Interessen der Verbraucher oder der Umwelt berücksichtigt wurden. Beobachten Sie inzwischen einen Wandel hin zu einer ausgewogeneren Lobbyarbeit in der EU?
Nein, leider nicht. Die Autolobby hat das schlechte Image durch den Diesel-Skandal abgeschüttelt und verhält sich wieder so wie vor Dieselgate – mit Arroganz, Lügen über die Auswirkungen von Umweltvorschriften und einem Gefühl der Straffreiheit. Sie behauptete etwa, dass die CO2-Standards für 2025 15 Milliarden Euro kosten würden, was nicht stimmt. Die Politiker:innen sollten sich daran erinnern, dass die kurzfristigen Interessen der Automanager nicht gleichzusetzen sind mit den langfristigen Interessen der Gesellschaft.
Wir erleben Diffamierungskampagnen gegenüber NGOs und der Zivilgesellschaft, zuerst in Brüssel, aber jetzt auch deutlich in Deutschland. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht bzw. wie gehen Sie damit um?
Es käme den Unternehmensinteressen entgegen, wenn die NGOs in der öffentlichen Debatte nicht präsent wären. Auf diese Weise könnten sie Entscheidungen über Umweltverschmutzung, Klima und Sicherheit monopolisieren. Die Frage, die sich Politiker:innen der rechten Mitte stellen müssen, ist, ob im Zeitalter von Trumpismus und Putinismus wirklich die Zivilgesellschaft eine Bedrohung für die Demokratie darstellt. Meiner Meinung nach ist es gut, eine starke Zivilgesellschaft zu haben, die zu öffentlichen Debatten beiträgt und ein wichtiges Gegengewicht zu den Eigeninteressen der Industrie bildet. Am Ende entscheiden die Politiker:innen. Aber sie werden der Gesellschaft erklären müssen, warum sie Gruppen angreifen, die die Interessen eines breiten Spektrums von Bürgerinnen und Bürgern vertreten.
Weitere Informationen:
- Mehr zum Ergebnis des Autogipfels gibt es in der Presseerklärung von T&E (englisch) hier zu lesen.
- Blog: Warum eine starke Zivilgesellschaft und ihre Organisationen so wichtig sind.
- Blog: E-Fuels: Dreiste Lobbykampagne gegen das Verbrenner-Aus