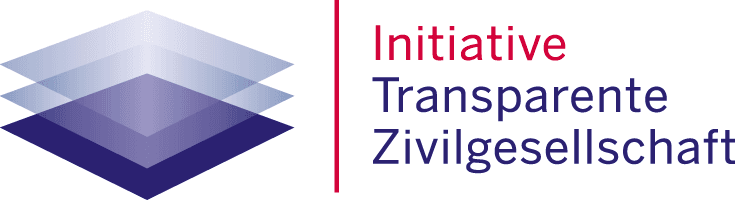In Brüssel nimmt eine neue politische Agenda Gestalt an, die den Abbau von Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards zugunsten wirtschaftlicher Interessen forciert. Treiber und Hauptprofiteure dieser Entfesselungs-Agenda in Brüssel sind Konzernlobbys. Unterstützt werden sie von deutschen Politiker*innen der Unionsparteien: Bundeskanzler Merz, Kommissionspräsidentin von der Leyen und EVP-Fraktionschef Weber im Europaparlament. In Deutschland wird bislang kaum über diesen fundamentalen Kurswechsel diskutiert. Dieser Beitrag zeigt, worum es geht – und wer davon profitiert.
Ein Paradigmenwechsel
Die erste Amtszeit von Kommissionspräsidentin von der Leyen von 2019-2024 war durch eine Vielzahl neuer Gesetze geprägt – den European Green Deal, neue Digitalgesetze oder das EU-Lieferkettengesetz, um nur einige zu nennen. Diese Vorhaben sollen Mensch und Umwelt vor negativen Folgen wirtschaftlicher Aktivitäten schützen: etwa im Bereich Chemikalien, Klimaschutz oder digitale Grundrechte. Sie sollen auch für die Einhaltung von Menschenrechten in den Lieferketten von Unternehmen sorgen.
Doch viele dieser Regeln stehen seit Beginn der neuen Wahlperiode nun auf dem Prüfstand. Das politische Argument: Schutzregeln würden die sogenannte Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und das Wirtschaftswachstum gefährden. Vor diesem Hintergrund sollen Regelungen abgeschwächt, ausgesetzt oder gar abgeschafft werden, um im globalen Wettbewerb – vor allem mit China und den USA – zu bestehen. Sogar die Sozialstandards und Arbeitsbedingungen der Sozialleistungen der Mitgliedstaaten hat die EU als „Wachstumsbremser“ im Visier. Der Vergleich mit China und den USA, wo geringere soziale und ökologische Standards herrschen, dient dabei als Begründung für eine Abkehr vom bisherigen Kurs.
Abkehr von Schutzregeln auf Wunsch der Industrielobby
Die Europäische Union war über Jahre hinweg eine treibende Kraft für hohe Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards. Viele ihrer Regelwerke – wie die Chemikalienverordnung REACH oder die Datenschutz-Grundverordnung – galten international als Vorbild. Doch nun droht eine Abkehr von diesem Kurs. In ihrer zweiten Amtszeit plant Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, zentrale Schutzregelungen gezielt zu lockern oder abzubauen. Die angekündigte „Überprüfung“ bestehender Gesetze bedeutet in der Praxis: weniger Kontrolle, weniger Auflagen – und mehr Handlungsspielraum für Unternehmen.
Diese Entwicklung ist das Ergebnis eines intensiven und erfolgreichen Lobbyings der Industrie. Besonders deutlich zeigt das die Antwerpener Erklärung führender Industrievertreter*innen im Januar 2024. Führende Vertreter*innen großer Industriezweige – allen voran der Chemiebranche – forderten darin massive Deregulierung. Ihr Ziel: möglichst weitreichende Erleichterungen für Unternehmen, verbunden mit der Schwächung bestehender Schutzregelungen. Die Forderung nach einem umfassenden Omnibus-Verfahren zur pauschalen Überarbeitung ganzer Gesetzesbereiche (siehe unten) stand dabei an erster Stelle. Kommissionspräsidentin von der Leyen war bei der Veröffentlichung der Erklärung persönlich anwesend.
Ein Jahr später, im Januar 2025, erklärte sie auf einer weiteren Industriekonferenz in Antwerpen offen, sie habe die Botschaft verstanden – und werde alle zehn industriepolitischen Empfehlungen der Erklärung aufgreifen. Damit macht sich die Kommission zur politischen Vollstreckerin einer Agenda, die klar den Interessen großer Konzerne folgt – und zentrale Errungenschaften europäischer Schutzpolitik zur Disposition stellt.
Agenda für Wettbewerbsfähigkeit = Agenda für Abschwächung unserer Regeln
Was in Brüssel derzeit passiert, hat das Potenzial, zentrale Errungenschaften europäischer Gesetzgebung grundlegend zu untergraben – mit weitreichenden Folgen für Umwelt, Verbraucher*innen und soziale Rechte. Die EU-Kommission treibt unter dem Deckmantel der sogenannten Agenda für Wettbewerbsfähigkeit eine umfassende Deregulierungswelle voran. Ihr Ziel: Vorschriften abbauen, die aus Sicht der Wirtschaft als „Belastung“ gelten – unabhängig davon, welchen gesellschaftlichen Nutzen sie entfalten.
Unterstützt wird diese Linie von einflussreichen Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, und getragen von einem politischen Klima, das wirtschaftliche Interessen zunehmend über Gemeinwohlbelange stellt. Die Initiative ist nicht neu: Bereits 2015 hatte die Kommission mit der sogenannten Agenda für bessere Rechtsetzung (Better Regulation) ein politisches Rahmenwerk geschaffen, das auf den Abbau von Regulierungen ausgerichtet war. Mit Gremien wie dem Regulatory Scrutiny Board und der Refit-Plattform wurde der Einfluss wirtschaftlicher Interessen auf Gesetzgebungsverfahren systematisch ausgebaut – zulasten parlamentarischer Kontrolle und Transparenz.
Neu ist jedoch die Wucht, mit der diese Agenda nun vorangetrieben wird. Erstens setzt sie auf bereits existierende Strukturen auf und radikalisiert deren Ausrichtung. Zweitens profitiert sie von den aktuellen politischen Mehrheitsverhältnissen im EU-Parlament und in den Mitgliedstaaten – und kann damit schneller und umfassender umgesetzt werden als je zuvor.
Kernbegriffe dieser Agenda wirken auf den ersten Blick technokratisch und harmlos: Wettbewerbsfähigkeit, Vereinfachung, Omnibus, 28th Regime, Realitätschecks und Implementierungsdialoge. Tatsächlich verbergen sich hinter diesen Begriffen jedoch hochpolitische Prozesse, deren Folgen oft erst auf den zweiten Blick sichtbar werden – mit dem klaren Ziel, Schutzstandards systematisch auszuhöhlen.
1. Wettbewerbsfähigkeit: Ein politisches Schlagwort mit einseitiger Wirkung
Kaum ein Begriff prägt die aktuelle EU-Politik so stark wie die sogenannte Wettbewerbsfähigkeit. In Sonntagsreden allgegenwärtig, in politischen Programmen prominent verankert – doch kaum klar definiert. Genau darin liegt das Problem: Der Begriff dient zunehmend als politisches Totschlagargument, um sozial- und umweltpolitische Standards infrage zu stellen oder gezielt abzubauen.
Ursprünglich beschreibt Wettbewerbsfähigkeit die Fähigkeit von Unternehmen, mit innovativen Produkten und Dienstleistungen auf dem Weltmarkt zu bestehen. Doch in der aktuellen EU-Debatte steht nicht Innovation im Vordergrund – sondern der Abbau von Pflichten und Rechenschaft. Damit verschiebt sich der Fokus: Nicht bessere Produkte, sondern „günstigere“ Bedingungen für Unternehmen stehen im Zentrum. Gemeint sind vor allem niedrigere Kosten – durch weniger Regulierung, weniger Kontrolle, weniger Verantwortung.
Ein zentraler Bezugspunkt der Agenda ist der Wettbewerbsfähigkeitsbericht des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, den er im Herbst 2024 im Auftrag der Kommission vorlegte. Der Bericht ist unter einseitigem Einfluss erstellt worden und liefert politische Argumente für umfassenden Abbau von Regeln. Draghi zeichnet ein düsteres Bild: Europa drohe im globalen Wettbewerb abgehängt zu werden – und müsse deshalb umsteuern. Die Botschaft: weniger Regulierung, mehr Wachstum – koste es, was es wolle.
Konkret geht es etwa um Strompreise, Umweltvorgaben, Berichtspflichten oder menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in Lieferketten. Wirtschaftsverbände bezeichnen diese Standards als „Kostenfaktoren“, die angeblich die globale Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Die Kommission greift diese Argumentation auf – und plant unter anderem, das Wettbewerbsrecht so zu lockern, dass künftig mehr Fusionen großer Konzerne möglich werden. Der Aufbau sogenannter European Champions wird aktiv gefördert, auch wenn dies den Wettbewerb einschränkt.
Das Paradoxe: Regeln, die Unternehmen zu verantwortungsvollem Handeln verpflichten – etwa zu fairem Umgang mit Beschäftigten, zum Schutz der Umwelt oder zur Einhaltung digitaler Grundrechte – gelten zunehmend als Hindernis. Statt die Wirtschaft zukunftsfähig und resilient zu machen, verlegt sich die Agenda auf kurzfristige Standortlogik: weniger Standards, mehr Freiräume für Konzerne.
Die Kosten für diese „Wettbewerbsfähigkeit“ zahlt am Ende die Allgemeinheit. Umweltbelastungen, Datenschutzlücken oder Missachtung von Arbeitsrechten verschwinden nicht – sie werden lediglich aus den Bilanzen der Unternehmen herausgerechnet und auf die Gesellschaft abgewälzt. Die Wettbewerbsfähigkeitsagenda ist damit keine Antwort auf globale Herausforderungen, sondern ein Rückschritt auf Kosten vieler.
2. „Vereinfachung“: Beschönigende Rhetorik für systematischen Abbau von Schutzstandards
„Vereinfachung“ klingt zunächst nach einer sinnvollen Maßnahme – nach mehr Effizienz, weniger Bürokratie und besserer Verständlichkeit. Doch was die EU-Kommission unter diesem Begriff versteht, geht weit darüber hinaus. In der aktuellen politischen Praxis dient „Vereinfachung“ zunehmend als Tarnbegriff für den gezielten Abbau von Schutzregeln.
Noch im Europawahlkampf 2024 betonte die Kommission, es gehe keinesfalls um eine Senkung von Standards, sondern lediglich um eine administrative Entlastung. Spätestens mit der Veröffentlichung ihres „Kompasses für Wettbewerbsfähigkeit“ im Januar 2025 ließ sie diese rhetorische Zurückhaltung fallen. In dem Dokument heißt es erstmals offen, dass Regulierung künftig stärker auf Vertrauen statt auf Kontrolle setzen solle.
Diese Abkehr von Kontrolle bedeutet in der Praxis nichts anderes als eine faktische Schwächung von Regeln. Denn viele Vorgaben entfalten ihre Wirkung nur dann, wenn ihre Einhaltung überprüft wird – sei es durch Berichtspflichten, Inspektionen oder Sanktionen. Wird auf solche Instrumente verzichtet, bleiben Gesetze oft folgenlos. Schon jetzt fehlt es der EU an ausreichenden Ressourcen, um geltende Vorschriften konsequent durchzusetzen. Weitere Abschwächungen bei der Kontrolle würden diesen Zustand noch verschärfen.
Die Beispiele sind zahlreich: Die Datenschutz-Grundverordnung gilt zwar als wegweisend, doch ihre Umsetzung wird in vielen Unternehmen nur unzureichend geprüft. Auch die Chemikalienregulierung REACH enthält hohe Standards – deren Einhaltung aber häufig nicht systematisch kontrolliert wird. Der Impuls der Kommission, hier künftig noch stärker auf „Vertrauen“ zu setzen, konterkariert den eigentlichen Zweck dieser Gesetze.
Der Verweis auf angebliche Bürokratie ist daher irreführend. In vielen Fällen geht es nicht um überflüssige Formulare, sondern um zentrale Mechanismen rechtsstaatlicher Kontrolle. Wer sie abschafft, öffnet gezielt die Tür für Regelverstöße – und schwächt die Durchsetzungskraft demokratisch beschlossener Gesetze. Der VW-Abgasskandal hat gezeigt, wohin es führt, wenn Kontrolle durch „Vertrauen“ ersetzt wird.
3. Vorfahrt für den „Omnibus“ – Vorfahrt für laxere Gesetze und Regeln
Ein weiteres zentrales Instrument der Deregulierungsagenda ist das sogenannte Omnibus-Verfahren. Der Begriff klingt harmlos und technisch – tatsächlich steht er für ein politisches Vorgehen, mit dem die EU-Kommission bestehende Gesetze gebündelt abschwächen oder überarbeiten will. Der Name stammt vom lateinischen „für alle“ bzw. „vollständig“ – und genau das ist Programm: Gleich mehrere Regelwerke eines Themenbereichs werden gleichzeitig und im Eilverfahren durchleuchtet und verändert.
Was wie ein Verwaltungsakt erscheint, ist politisch hoch brisant. Denn Omnibus-Verfahren erlauben es, breite Eingriffe vorzunehmen – ohne die übliche Gesetzgebungstiefe und ohne die öffentliche Aufmerksamkeit, die Einzelverfahren erzeugen würden. Formal müssen auch diese Änderungen vom EU-Parlament und vom Rat beschlossen werden. Doch durch die Bündelung entstehen für Parlamentarier*innen und Zivilgesellschaft erhebliche Hürden in der Kontrolle und Einflussnahme.
Stand Juli 2025 laufen bereits fünf Omnibus-Verfahren. Weitere sind angekündigt. Die Themen reichen von Nachhaltigkeitsberichterstattung über Investitionsprogramme bis hin zu Datenschutz und Umweltrecht. Hinter allen steht die gleiche Stoßrichtung: Berichtspflichten abbauen, Kontrollinstrumente zurückfahren, Schutzstandards aufweichen.
Zu diesen fünf Bereichen laufen derzeit Omnibus-Verfahren
Omnibus I zum Thema Nachhaltigkeit: er erfasst die Berichtspflichten im EU-Lieferkettengesetz (CSDDD), Nachhaltigkeit (CSRD), beim CO2-Grenzausgleichmechanismus (CBAM) und bei der Taxonomie;
Omnibus II zu Investitionsprogrammen (InvestEU, EFSI und weitere Finanzinstrumente);
Omnibus III zur Landwirtschaft, insbesondere zur Gemeinsame Agrarpolitik (GAP);
Omnibus IV soll Regeln im Binnenmarkt und bei der Digitalisierung behandeln:
Er behandelt unter anderem die Einführung einer neuen Kategorie von Unternehmen, den sogenannten Small Midcaps (SMCs), die künftig weniger regulatorische Auflagen haben sollen, so u.a. beim Datenschutz, aber auch bei Energiefragen.
Datenschutz: Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) soll grundlegend überarbeitet werden.
Es gilt als wenig wahrscheinlich, dass der Omnibus den Digital Markets Act (DMA) und den Digital Services Act (DSA) betrifft, weil die Gesetze ausschließlich große Tech-Konzerne regulieren. Betroffen sind diese Gesetze allerhöchstens indirekt an den Punkten, wo sie Schnittstellen zur Datenschutzgrundverordnung haben.
Omnibus V zu Verteidigungs-Themen soll die Beschaffung von Rüstungs- und Verteidigungsgütern erleichtern und bessere Förderung für Verteidigungsprojekte gewährleisten.
Diese Omnibus-Verfahren hat die EU-Kommission für das zweite Halbjahr 2025 angekündigt
Auch bei der Chemiekalienregulierung plant die EU-Kommission im Zusammenhang mit dem Chemie-Aktionsplan ein Omnibus-Verfahren.
Im Bereich Digitalisierung sind unabhängig vom Binnenmarkt (Omnibus IV) weitere „Überarbeitungen“ der Gesetze geplant: beim Data Act, Data Governance Act, AI Act und der Open Data Directive.
Besorgniserregend ist auch der angekündigte Omnibus im Umweltbereich: Es geht um die Reduktion von Berichtspflichten zu Produktregulierung, Abfall und Industrieemissionen und wohlmöglich um die Reduzierung der Erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) z. B. für Verpackungen, Elektrogeräte, Batterien.
Im Bereich der Klimapolitik ist ebenfalls ein Omnibus-Verfahren geplant. Hier sollen drei Richtlinien überprüft werden, die Energie-Effizienzrichtlinie, die Erneuerbare-Energien-Richtlinie und die Richtlinie für Gebäude-Energieeffizienz.
Auch die Automobilbranche bekommt ihren Omnibus im Zusammenhang mit dem „Aktionsplan Auto.“ Weitere Details sind hier noch nicht bekannt.
Fazit: Omnibus-Verfahren sind keine neutralen verfahren, sondern ein machtvolles politisches Instrument. Unter dem Vorwand der Effizienz betreibt die Kommission den gezielten Abbau von Regeln – häufig mit unmittelbaren Folgen für Klima, Umwelt, Verbraucher*innen und soziale Rechte. Durch die Bündelung verschiedener Regelwerke steigt zudem die Intransparenz. Kritische Öffentlichkeit und Parlament laufen Gefahr, systematisch an Einfluss zu verlieren.
„28th Regime:“ Ein Einfallstor für Sozialdumping und Steuertricks
Mit dem sogenannten 28th Regime plant die EU-Kommission einen weitreichenden Eingriff in nationale Kompetenzen – insbesondere im Bereich der Sozial- und Steuerpolitik. Was technisch klingt, birgt erheblichen politischen Sprengstoff: Unternehmen mit Standorten in mehreren Mitgliedstaaten sollen künftig unter einem einheitlichen arbeits- und sozialrechtlichen Rahmen agieren können – unabhängig von den geltenden nationalen Standards.
In der Praxis könnte das bedeuten: Unternehmen könnten sich gezielt auf den schwächsten Schutzstandard in der EU berufen – etwa bei Arbeitszeiten, Mitbestimmungsrechten oder Sozialabgaben. Nationale Schutzregelungen, etwa in Deutschland oder den skandinavischen Ländern, würden dadurch systematisch untergraben.
Die Initiative wird unter dem Vorwand der „Vereinfachung“ und Effizienzsteigerung propagiert, läuft aber auf eine Aushöhlung des Sozialmodells der EU hinaus. Sie steht im direkten Widerspruch zu den in den EU-Verträgen verankerten Prinzipien der Subsidiarität und der sozialen Kohäsion.
Auch die Steuerpolitik wäre betroffen: Das 28th Regime eröffnet neue Möglichkeiten für Steuervermeidung, indem Unternehmen länderspezifische Vorgaben umgehen und sich auf eine zentrale Anlaufstelle berufen könnten. Gerade große Konzerne wären in der Lage, ihre Steuerlast weiter zu senken – zulasten nationaler Haushalte.
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) hat das Vorhaben daher scharf kritisiert. Er warnt vor einem Systemwettbewerb nach unten, der Arbeitnehmerrechte schwächt und soziale Ungleichheit vertieft. Die Vorschläge der Kommission stünden in diametralem Gegensatz zum Ziel eines sozialen Europas.
Neue Strukturen, die systematisch Konzerneinfluss auf Politik stärken
Neben dem gezielten Abbau von Schutzstandards baut die EU-Kommission neue politische Strukturen auf, die den Einfluss von Konzernlobbys weiter verstärken – auf Kosten demokratischer Beteiligung und öffentlicher Kontrolle. Im „Wettbewerbsfähigkeitskompass“ vom Januar 2025 kündigte die Kommission zwei neue Formate an: sogenannte Implementierungsdialoge und Realitätschecks.
Beide Formate sollen den Austausch zwischen Politik und Wirtschaft institutionalisieren – jedoch unter höchst unausgewogenen Bedingungen. Denn gerade in Brüssel ist das Kräfteverhältnis zwischen Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Akteuren ohnehin stark verschoben: Konzernlobbyist*innen verfügen über unvergleichlich mehr Ressourcen, Personal und Zugangsmöglichkeiten. Diese Asymmetrie wird nun weiter zementiert.
Implementierungsdialoge sind Treffen zwischen Behörden und Unternehmensvertreterinnen, bei denen es offiziell um die „Praxisnähe“ von Regulierung geht. In der Realität erhalten Konzerne damit eine Plattform, um gezielt auf Gesetzesinhalte einzuwirken – häufig schon vor oder während der Umsetzung. Die Perspektive von Gewerkschaften, Umweltorganisationen oder Verbraucher*innen spielt dabei oft nur eine Nebenrolle – wenn überhaupt.
Realitätschecks sollen prüfen, ob bestehende oder geplante Regeln für Unternehmen „zumutbar“ sind. Auch hier steht nicht der gesellschaftliche Nutzen von Gesetzen im Mittelpunkt, sondern deren wirtschaftliche „Belastung“. Die Folge: Schutzstandards werden zunehmend unter Effizienzgesichtspunkten betrachtet – nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer Wirksamkeit oder Notwendigkeit.
Beide Formate folgen einer Logik, die demokratische Prozesse umgeht: Statt im Parlament oder über öffentlich zugängliche Konsultationen wird Politik im engen Kreis verhandelt – mit privilegiertem Zugang für wirtschaftlich mächtige Akteure. Diese Verschiebung politischer Machtverhältnisse läuft auf eine strukturelle Bevorzugung unternehmerischer Interessen hinaus – zum Nachteil der Allgemeinheit.

Angriffe auf die Zivilgesellschaft: Kritische Stimmen unter Druck
Während die EU-Kommission Konzernlobbyist:innen zusätzlichen Einfluss ermöglicht, betreiben gleichzeitig die Konservativen und Rechtsextremen im Europäischen Parlament eine Diffamierungskampagne gegen die Zivilgesellschaft und verschärfen damit weiter die Machtungleichgewichte bei der Interessenvertretung.
Insbesondere Umwelt- und Menschenrechts NGOs stehen im Fokus der Kampagne. Dafür nutzt die Europäische Volkspartei (EVP), die Partei von CDU und CSU in Brüssel, völlig unverhohlen Mehrheiten mit rechtsextremen, anti-demokratischen und anti-europäischen Parteien wie der ungarischen Fidesz und dem französischen Rassemblement National.
Zuletzt richtete das Europäische Parlament im Juni 2025 eine Arbeitsgruppe zur Untersuchung der Finanzierung von Nicht-Regierungsorganisationen ein. Die Arbeitsgruppe ist eine neue Wendung in den seit Monaten andauernden Versuchen, finanzielle Förderungen von Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen durch die EU als unrechtmäßig zu diskreditieren.
Dabei stützt sie sich auf falsche Erzählungen von angeblichen Geheimverträgen und Lobbyarbeit von NGOs im Auftrag der EU-Kommission. Mehrfach wurden diese Vorwürfe inzwischen widerlegt. Es geht der CDU/CSU mit dieser Arbeitsgruppe nicht um Erkenntnisinteresse und Aufklärung, sondern darum, unliebsame zivilgesellschaftliche Organisationen zu schwächen, die für starke Regeln in der EU stehen. Das erinnert an Viktor Orbán und Donald Trump.
Das unheilige deutsche Trio: Wie Merz, von der Leyen und Weber den Schutz europäischer Standards aufweichen
Angriffe auf die Zivilgesellschaft, eine konzernfreundliche Agenda zur Abschwächung von Europas Regeln sowie die Schaffung neuer, zusätzlicher Einfluss-Strukturen für Konzern-Lobbyisten kommen aus einer Hand. Politische Treiber der Konzernlobby-Agenda aus der Antwerpen Erklärung der Industrie sind bedauerlicherweise führende Kreise der CDU/CSU aus Deutschland.
Bundeskanzler Merz selbst machte deutlich, dass eine „überbordende Regulierung und Bürokratie [...] heute der Hauptgrund dafür [sei], dass die Produktivität der EU immer weiter hinter die der USA und Chinas zurückfällt.“ Deshalb begrüßte er ausdrücklich die neue Wettbewerbsfähigkeitsagenda der EU – also jene Strategie, mit der Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards als vermeintliche Wachstumshemmnisse infrage gestellt werden.
Ursula von der Leyen, die in ihrer ersten Amtszeit noch den Green Deal und das Lieferkettengesetz mit auf den Weg gebracht hatte, vollzog im Vorfeld ihrer erneuten Nominierung zur Kommissionspräsidentin im Februar 2024 einen politischen Kurswechsel. Ihre Wiederaufstellung durch die konservative EVP erfolgte unter der klaren Bedingung, künftig „Wettbewerbsfähigkeit“ und den Abbau „bürokratischer Lasten“ ins Zentrum ihrer Arbeit zu stellen.
Im Europäischen Parlament orchestriert der Fraktionschef der Europäischen Konservativen Manfred Weber (CSU) die Agenda. Im Januar 2025 einigte er sich gemeinsam mit Merz in Berlin auf eine Erklärung, die den systematischen Abbau bestehender Regeln zum Ziel erklärt – ein politisches Schulterschluss-Signal an die Industrie.
Dabei sind diese Vorhaben nicht unumstritten – auch nicht innerhalb der Union. Doch die derzeit tonangebenden Kräfte setzen konsequent auf Deregulierung, privilegierten Zugang für Lobbyist*innen und Kooperationen mit rechtsautoritären Kräften im Parlament. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Unterstützung der EVP für die oben beschriebene Kampagne gegen zivilgesellschaftliche Organisationen.
Verunsicherung in unsicheren Zeiten: Warum diese Agenda brandgefährlich ist
Die Europäische Union steht vor gewaltigen Herausforderungen: geopolitische Spannungen, wirtschaftlicher Druck, Klimakrise, soziale Ungleichheit. In diesen unsicheren Zeiten setzt die EU-Kommission mit Rückendeckung von konservativen Teilen des EU-Parlaments und Regierungen der Mitgliedstaaten auf eine Politik, die das Vertrauen in den Staat und dessen Durchsetzungsfähigkeit schwächt und gleichzeitig die Macht von Unternehmen stärkt.
Was als Stärkung der „Wettbewerbsfähigkeit“ verkauft wird, ist in Wahrheit ein riskanter Umbau europäischer Politik: Wer Regeln abschwächt, mehr Einfluss für Konzern-Lobbyisten schafft und gleichzeitig kritische Stimmen im öffentlichen Raum an den Pranger stellt, der schafft kein Vertrauen in die europäische Demokratie und den Staat, sondern das Gegenteil. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Schon jetzt gibt es autoritären Kräften Aufschwung.
Dagegen müssen wir uns entschlossen wehren. Eine Agenda, die vor allem Privilegierten nützt und Kritiker*innen ausschließt, müssen wir als europäische Zivilgesellschaft mit aller Kraft bekämpfen. Wir stehen für die Durchsetzung demokratisch geschaffener Regeln. Wir stehen für eine lebendige und starke europäische Demokratie. Jetzt ist der Moment zu handeln, bevor Konzerne die Demokratie mit Hilfe der derzeit dominierenden konservativen Kräfte in Deutschland und Europa kapern.

Machen Sie sich mit uns für Lobbykontrolle stark!
Wir decken Missstände auf und setzen einseitigem Lobbyismus Grenzen. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende.
Jetzt spenden!