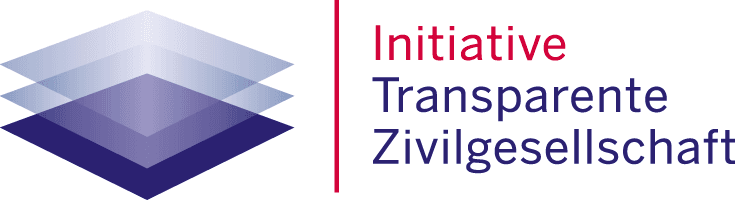In Deutschland und in der EU macht die Gaslobby mächtigen Druck für den Erhalt ihres fossilen Geschäftsmodells – dabei ist es ihr gelungen, dass Wasserstoff eine zentrale Rolle in der Energiewende zugeschrieben wird. Keine Frage, der Stoff ist ein Baustein für den Klimaschutz. Doch je größer der Durst nach ihm wird, umso mehr profitiert vor allem einer: die Gasindustrie.
Wasserstoff gilt vielen Industrien als Hoffnungsträger – doch zurecht?
Er wird derzeit zum Wundermittel im Kampf gegen den Klimawandel stilisiert. Zahlreiche Industrien sehen ihn als Lösung für die Energiewende. Denn er weckt bei vielen Branchen die Hoffnung, ihr bisheriges Geschäft mit ein paar kleineren Veränderungen einfach weiterführen zu können. So hoffen manche Akteure der Automobillobby, durch seine Nutzung mit Hilfe von so genannten „e-fuels“, also synthetischen Kraftstoffen, die Zukunft des Verbrennungsmotors retten zu können. Auch die Immobilienwirtschaft würde gerne deutlich weniger dämmen und dafür Häuser, die nicht auf dem neuesten Energiestandard sind, mit ihm beheizen. Und die Gasindustrie könnte ihr Geschäftsmodell auf Jahre verlängern, indem sie den enormen Durst nach dem Gas mit ihrem fossilen Brennstoff stillt.
Es geht um Wasserstoff. Bei der Umwandlung von Wasserstoff in Strom fällt als einziges Abfallprodukt Wasser an, also kein CO2; Wasserstoff ist außerdem vergleichsweise einfach zu lagern und zu transportieren. Allerdings ist er nur dann klimafreundlich, wenn er aus erneuerbaren Energien hergestellt wird (so genannter „grüner“ Wasserstoff). Der Energieaufwand seiner Gewinnung ist hoch – Expert*innen sprechen von bis zu acht Mal so viel Energie, als wenn man erneuerbare Energien direkt nutzen würde. Den für die Energiewende durchaus wichtigen Stoff sollte man deshalb vernünftigerweise nur dort einsetzen, wo es keine andere Möglichkeit gibt, argumentieren zahlreiche Expert*innen, etwa die Wissenschaftlerin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Zu nennen sind hier vor allem die Stahl- und die Chemieindustrie, Flugzeuge oder eventuell auch große Nutzfahrzeuge.
Gasindustrie fordert Einsatz von Wasserstoff aus Gas ein
Doch unklar ist bislang, ob und wann es je genügend Strom aus der erneuerbaren Wasser-, Wind und Solarkraft geben wird, um den gigantischen Bedarf zu stillen. Hier kommt die Gasindustrie ins Spiel. Denn bisher wird ein Großteil des derzeit genutzten Wasserstoffs mit Erdgas hergestellt. So könnte es auch noch lange bleiben, wenn es nach dem Willen der Industrie geht: Im Juni 2020 forderte eine Koalition von Unternehmen und Verbänden in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass eine Wasserstoffstrategie alle Arten von Wasserstoff miteinbeziehen sollte, auch sogenannten blauen Wasserstoff. Blau wird Wasserstoff genannt, der aus Erdgas hergestellt wird. Dabei entsteht CO2, das im Nachhinein mithilfe der „Carbon-Capture-and-Storage-Technologie“ (CCS) aufgefangen und im Boden gespeichert werden soll. Dennoch ist die CO2-Emission auch mit modernen Anlagen deutlich höher als die von grünem Wasserstoff, nach Berechnungen von Greenpeace mindestens 5 Mal so hoch. Das Argument: Da es bisher so wenig grünen Wasserstoff gibt, soll mit blauem Wasserstoff eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut und dieser dann mit der Zeit durch grünen ersetzt werden.
Auch in Deutschland fordern dies Gasunternehmen wie Wintershall Dea, Uniper oder der Lobbyverband Zukunft Gas. Das Problem: Damit könnten Abhängigkeiten von Wasserstoff geschaffen werden, die mit Hilfe von grünem Wasserstoff gar nicht zu stillen sind, da es zumindest noch auf lange Sicht weniger davon geben wird, auch wenn die Bundesregierung jetzt fleißig nach internationalen Wasserstoffkooperationen sucht. Denn in südlichen Ländern, wo mehr Sonnenstrom erzeugt werden könnte, wäre es ja sinnvoll, mit diesem erst mal den eigenen Strombedarf vor Ort zu decken, statt den deutschen/europäischen Energiebedarf auch dort zu decken, wo erneuerbare Energien direkt eingesetzt werden könnten. Das Thema hat also auch eine geopolitische Komponente: Mit was für Regimen möchte man unter welchen Bedingungen für die Bevölkerung Wasserstoffpartnerschaften eingehen?
„Technologieoffenheit“ als Mantra der Lobbyisten
Stellt die Gasindustrie also die Weichen geschickt und kann die Nutzung von Wasserstoff und synthetischen Gasen (auf Basis von Wasserstoff) für möglichst viele Bereiche durchsetzen, müsste man noch lange auf Wasserstoff zurückgreifen, der in irgendeiner Weise mit Hilfe von Erdgas hergestellt wird. Ein Schlüsselbegriff in der Lobbydebatte ist hierbei die „Technologieoffenheit“. Damit wird suggeriert, es würden bestimmte Technologien aus Engstirnigkeit ausgebremst – obwohl es sich im Fall von Wasserstoff eigentlich um eine Effizienzentscheidung handelt: Nämlich den Wasserstoff mit seinen guten Eigenschaften, aber seinem hohen Energieaufwand in der Gewinnung nur dort einzusetzen, wo er wirklich gebraucht wird.
Deutsche Wasserstoffstrategie stellt grünen Wasserstoff in den Vordergrund
In Deutschland ist es der Gasindustrie im „Dialogprozess Gas 2030“ zunächst einmal gelungen, dass das Bundeswirtschaftsministerium der Rolle gasförmiger Energieträger bei der Energieversorgung der Zukunft eine wichtige Rolle zugeschrieben hat. Auch forderte ein zunächst durchgesickerter Entwurf der Gasstrategie von Februar 2020, Wasserstoff in nahezu allen Bereichen einzusetzen. Zur Erinnerung, der vom Minister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, initiierte „Dialogprozess“ war allein der Gasindustrie vorbehalten, andere Akteure hatten kaum Zutritt und wussten auch lange gar nichts von diesem Prozess (LobbyControl berichtete). Die Gasindustrie hat hier mit Hilfe privilegierte Zugänge ihre Zukunft im Kampf gegen den Klimawandel gesichert. Allerdings hat sich im Zerren um die Frage der Bedeutung von blauem Wasserstoff vorerst das Bundesumweltministerium durchgesetzt: Stellte der erste Entwurf von Wirtschaftsminister Altmaiers Wasserstoffstrategie blauen und grünen Wasserstoff als CO2-frei gleich, nutzte das Bundesumweltministerium sein Mitspracherecht: In der finalen Version von Juni 2020 liegt der Schwerpunkt auf grünem, also mit erneuerbaren Energien hergestelltem Wasserstoff.
EU-Wasserstoffstrategie offen für Wasserstoff aus Gas und Atomstrom
Aber die Entscheidung ist noch lange nicht gefallen und wird in zahlreichen Institutionen und Gremien weiter entwickelt. Anders als die deutsche Wasserstoffstrategie sieht die im Sommer 2020 vorgestellte Wasserstoffstrategie der EU-Kommission blauen Wasserstoff zumindest vorläufig als Teil der Lösung. Und so investiert sie Milliarden in CCS-Projekte. Auch im Rahmen des Corona-Aufbauplans soll dieser Sektor begünstigt werden. In Deutschland ist die Technologie bis auf wenige Ausnahme-Projekte allerdings derzeit nicht erlaubt. Auch der EU-Ministerrat, das Gremium der EU-Mitgliedstaaten, hat sich bereits positioniert. Er will in seinen Schlussfolgerungen zur EU-Wasserstoffstrategie auch Wasserstoff aus Erdgas und sogar Atomstrom (violetter/pinker Wasserstoff) mittelfristig im Fahrplan berücksichtigt sehen.
Weiterentwicklung von Wasserstoff wird von unternehmensdominierten Gremien debattiert
Auf beiden Ebenen, in Deutschland und der EU, wirken jetzt von der EU-Kommission und der Bundesregierung ernannte Plattformen oder Räte an der Umsetzung der Wasserstoffstrategie mit.
In Deutschland hat die Bundesregierung den „Nationalen Wasserstoffrat“ berufen. Er soll die Arbeit an der Wasserstoffstrategie unabhängig begleiten. Die Liste der Mitglieder zeigt schon eine Vielfalt an Unternehmen, darunter natürlich auch Gasunternehmen und Gasnetzbetreiber. Besorgniserregend ist die Verteilung: Insgesamt sitzen 15 Unternehmen, 7 TeilnehmerInnen aus der Wissenschaft, die IG Bergbau Chemie Energie und gerade mal 2 Nichtregierungsorganisationen am Tisch. Diese können natürlich jederzeit überstimmt werden. Die industrielastige Zusammensetzung birgt die große Gefahr, dass weniger die Rolle von Wasserstoff für den Klimaschutz diskutiert wird – sondern eher, wie die verschiedenen Industrien von ihm profitieren können.
Auf EU-Ebene wurde die eine Plattform namens „Clean Hydrogen Alliance“ ins Leben gerufen. Sie soll vor allem die nötigen Investitionen vorschlagen und hat damit weitreichende Kompetenzen erhalten. Kein Wunder dass sich hier zahlreiche Unternehmen tummeln: Insgesamt finden sich auf der aktuellen Teilnehmer*innenliste (November 2020) 538 Unternehmen, 9 Banken, 142 Verbände, aber nur 7 Nichtregierungsorganisationen. Immerhin sind auch 74 Forschungseinrichtungen aufgelistet. Auch namhafte Gasakteure wie Uniper, Eon, Open Grid Europe oder der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sind dabei. Ihr klares Interesse dürfte sein, die Wasserstoffentwicklung in die richtige Richtung zu lenken: Fossiles Gas soll noch lange eine wichtige Rolle als Wasserstofflieferant spielen.
Lobbyakteure entdecken „soziale Komponente“ von Wasserstoff
Auch die Gasnetzbetreiber planen natürlich ihre Zukunft mit dem Wundergas. Ihnen schwebt vor, dass ihre Pipelines auf Wasserstoff umgerüstet und damit weiterverwendet werden. Das ist ihre Rettung, wenn die Bedeutung von Gas eines Tages zurückgeht.
Für die Fernleitungsnetzbetreiber gibt es hier Hoffnung, an einem Rechtsrahmen arbeitet die Bundesregierung bereits. Doch auch die Verteilnetzvertreiber, die das Gas bisher zu den Endkunden bringen, wollen im Geschäft bleiben. Wenn es nach ihnen geht, soll das Wasserstoffnetz bis in die Privathaushalte hineinreichen. Das widerspricht der eingangs erwähnten und von vielen vertretenen Expert*innenmeinung, dass Wasserstoff vor allem dort eingesetzt werden sollte, wo es keine günstigeren Alternativen gibt. Sie sehen eher Bedarf an Wasserstoff-Clustern, wo die Industrie sie braucht. Für das Beheizen von Gebäuden sind Erdwärme oder Solarthermie demnach besser geeignet.
Und so entbrennt hier gerade eine weitere Diskussion. Denn nicht nur die Verteilnetzbetreiber möchten gerne ihre Zukunft mit dem Wasserstoff sichern. Im Dezember erreichte Minister Peter Altmaier ein gemeinsamer dringlicher Brief der Gasindustrie und des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie, den Wärmemarkt und dessen Versorgung über die Gasverteilnetzebene nicht zeitlich nachrangig zu bedienen. Interessant ist dabei, wie stark von den Lobbyakteuren die soziale Komponente in den Vordergrund gestellt wird. Der Branchenverband Deutscher Verein für das Gas- und Wasserfach fordert, dass über die Beimischung von Wasserstoff ins Erdgasnetz „auch die Oma mit ihrem kleinen Häuschen“ sozialverträglich an der Energiewende teilhaben könne. Und auch das Unternehmen Eon, zu dem auch Verteilnetzbetreiber gehören, zieht die soziale Karte und argumentiert, dass das für die Wärmeversorgung ohne Gas nötige Dämmen in älteren Wohnhäusern hauptsächlich „Einkommensschwache“ treffe. Dies dürfte auch der Immobilienwirtschaft entgegenkommen, die ebenfalls lieber auf den Wasserstoff setzen würde als auf aufwändige und teure Gebäudedämmung.
Die Debatte um Einsatz, Bezug und Transport des Wundergases Wasserstoff wird die Klimadebatte in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren mitbestimmen. Der Gaslobby ist es dabei gelungen ihre fossilen Produkte sowohl für den Übergang zu einer C02-neutralen Wirtschaft als auch als Zukunftsenergie zu positionieren. LobbyControl wird hier genau hinsehen. Denn die Gaslobby ist mächtig und hat in Deutschland besonders großen Einfluss auf die Bundesregierung. Doch es darf nicht sein, dass am Ende fossile Wirtschaftsinteressen die Oberhand über die Zukunft der Energieversorgung gewinnen – statt dem Schutz des Klimas und das Überleben des Menschen auf dem Planet Erde.
Hinweis: Im Newsletter zu diesem Thema am 2.2.2021 haben wir Wasserstoff irrtümlicherweise als Edelgas bezeichnet. Wir bitten für diesen Fehler um Entschuldigung.
Bleiben Sie informiert über Lobbyismus.
Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.
Datenschutzhinweis: Wir verarbeiten Ihre Daten auf der Grundlage der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Art. 6 Abs. 1). Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Zur Datenschutzerklärung.