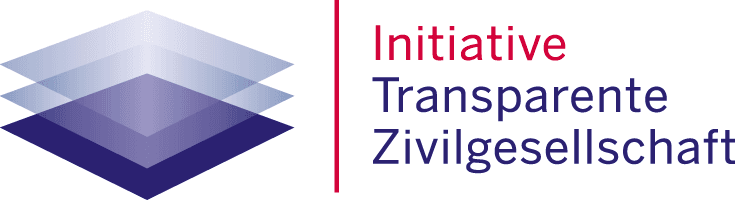An Deutschlands Schulen fehlt das Geld. Immer mehr Unternehmen sehen darin eine Chance. Sie bieten Unterstützung in Form von kostenfreien Unterrichtsmaterialien, Kooperationsverträgen oder Schulsponsoring an. Doch das Engagement geschieht nicht selten mit Hintergedanken. Neuestes Beispiel: Der Minirechner Calliope. Hinter dem stehen ausgerechnet Firmen wie der Internetgigant Google. Der macht zwar Milliardengewinne, zahlt in Deutschland aber so gut wie keine Steuern. Die Finanznot an Deutschlands Schulen, die Google vorgibt, durch seine Schenkung zu mildern, hat der Konzern also selbst mit befördert. Hinzu kommt: Mit der Schenkung nehmen Firmen wie Google subtil Einfluss. In diesem Fall ist es der direkte Eingriff in den Lehrplan. Der demokratische Entscheidungsprozess wird damit ausgehebelt.
Der Calliope Mini in Mecklenburg-Vorpommern
Der Calliope Mini ist ein Mini-Computer, mit dem Grundschüler ein Grundverständnis des Programmierens lernen sollen. Durch die Verwendung einer Creative-Commons-Lizenz für alle Materialien, Software und Hardware wird prinzipiell ein herstellerunabhängiger Betrieb ermöglicht. Nur: Wer hat die Ressourcen, solche Hardware oder Anwendungssoftware zu entwickeln und dann kostenlos weiterzugeben?
Am 17. Oktober 2017 gab die mecklenburg-vorpommerische Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) bekannt, dass 100 Klassensätze zu je 25 Mini-Computern an Grundschulen verteilt werden sollen. Jede zweite Grundschule soll von dieser Initiative profitieren. Der „edle Spender“ war die Calliope gGmbh, der gemeinnützige Hersteller eben jenes Mini-Computers. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch in anderen Bundesländern wie Saarland, Bremen und Niedersachsen, hat der Calliope Mini innerhalb kürzester Zeit nach Erscheinen Eingang in die Klassenzimmer gefunden. Bekannt wurde der Calliope Mini in der Netzwelt durch ein Crowdfunding. Um den Jahreswechsel 2016/17 wurden knapp über 100.000 Euro Spenden gesammelt und dafür insgesamt 38 Klassensätze Calliope Mini für Schulen produziert, sowie knapp 2000 private Calliope für die Spender. Mit diesem Geld lässt sich eine flächendeckende Einführung für alle Drittklässler, wie sie angestrebt wird, natürlich nicht umsetzen. Auch die Schulen haben nicht das Geld, um Mini-Computer für ihre SchülerInnen zu finanzieren.
Woher also kommt das Geld?
Aus eigenen Mittel könnte die Calliope gGmbH eine Einführung von Calliope an den Schulen nicht stemmen.Gegründet wurde die Calliope gGmbh von sechs GesellschafterInnen mit einem Kapital von 25.002 Euro. Aber alleine die Schenkung von 2500 Calliope Minis in Mecklenburg-Vorpommern hat laut Calliope gGmbH in der Produktion 75.000 Euro gekostet. Die Calliope gGmbh präsentiert dafür aber schon eine Lösung auf ihrer Webseite: „Partner, die uns unterstützen“. Dort zu finden sind Stifter von einzelnen Komponenten des Mini-Computers, sowie Hersteller von passender Software, Lernsoftware, Unterrichtsmaterialien und Onlinekursen. Als Partner hervor sticht Google. Der US-Konzern wird laut Webseite den „Einsatz des minis in weiteren Bundesländern unterstützen”. Genaue Zahlen sind nicht zu erfahren, weitere Geldgeber werden aber auch nicht benannt. Google finanziert darüber hinaus auch die Lernplattform OpenRoberta mit einer Million Euro, in die der Calliope Mini integriert ist. Weitere Recherchen zu den Finanzen der gGmbH gibt es im Blog Bildungsradar von René Scheppler. Klarheit zur Finanzierung könnte auch die Kleine Anfrage der Linken im mecklenburg-vorpommerischen Landtag bringen.
Ziel: Programmieren über die Hintertür in die Grundschulen bringen
Programmieren in der Grundschule ist bisher nicht vorgesehen. Die Calliope gGmbh gibt ihr Ziel für das Schulsystem auf ihrer Webseite aber offen zu: „Unser Wunsch ist es, dass digitale Bildung ab der Grundschule als ein fester Baustein im Curriculum verankert und von den Ländern angemessen budgetiert wird.“ Und nennt 5 Gründe „Warum Kinder prgrammieren lernen sollten“. Anstatt aber ihre Vorschläge in den demokratischen Prozess der Lehrplanentwicklung der Bundesländer einzubringen, hat sich Calliope anscheinend für einen anderen Weg der Einflussnahme entschieden: Die Schenkung.
Das normale Prozedere wäre Folgendes: Die Politik nimmt Vorschläge aus der Gesellschaft und Wissenschaft zur Veränderung des Curriculums (Lehrplans) auf und diskutiert diese in Anhörungen des Landesparlaments mit ExpertInnen. Dann entscheidet der Landtag über diese Änderungen und es erfolgt eine Implementierung in den Schulen des Landes. Ob schon in der Grundschule vom Programmieren lernen Nutzen ausgeht, ist wissenschaftlich bisher aber nicht belegt.
Also versucht Calliope über die Schenkung Fakten zu schaffen – mit Erfolg. In einigen Bundesländern sind die Mini-Computer schon im Einsatz. Weitere sollen folgen. Damit hebeln die „Stifter“ die politischen Entscheidungen des Landtags aus und platzieren neue, bislang im Lehrplan nicht vorgesehene, Unterrichtsinhalte. Die Problematik des fehlenden Lehrplanbezugs scheint auch den Calliope-Machern aufgefallen zu sein. In dem Material des Cornelsen-Verlags („Programmieren in der Grundschule“), dass auf Calliope-Seite als erstes pädagogisches Material angeboten wird, werden zahlreiche Hinweise auf den Lehrplan gegeben. Allerdings nicht für das Programmieren, sondern nur für die fertigen Programme, die dann als Werkzeuge für den Deutsch-, Mathe- oder Sachunterricht dienen.
Der Fall Calliope gibt Anlass zur Sorge. Wenn Internetfirmen Schulen mit Computern und ihrer Software ausstatten dürfen, um Lehrpläne zu umgehen, sollen dann in Zukunft auch Fastfoodketten Lebensmittel für den Ernährungsunterricht beisteuern oder Bankenverbände Gratismaterialien für das Fach Wirtschaft liefern, um damit eine Themensetzung innerhalb des Unterrichts zu erreichen, die der Lehrplan nicht vorsieht?
Ist das legal?
Die Regelungen zu Werbung und Sponsoring an Schulen sind in jedem Bundesland etwas unterschiedlich geregelt. Für Mecklenburg-Vorpommern scheint der vorliegende Fall den Verwaltungsvorschriften des Bildungsministeriums zu widersprechen. In den „Empfehlungen zur Werbung, Erhebung von Geldspenden, wirtschaftlichen Betätigung und zu Sammlungen an öffentlichen Schulen” des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird im Punkt 1.2.1 von einer Gefährdung des Bildungs- und Erziehungsauftrags ausgegangen, wenn „mit einer Zuwendung versucht wird, Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung von Unterricht und Erziehung zu nehmen“. Wenn viele Grundschulen eines Landes mit einem bestimmten Computer ausgestattet werden, wird aber eindeutig versucht, auf die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts Einfluss zu nehmen. Das Ministerium setzt sich hier also über seine eigenen Vorschriften hinweg.
Digitalisierung first, Bedenken second?
Keine Frage: Die Digitalisierung führt zu einer rasanten Umgestaltung der Gesellschaft, der Kommunikation und auch der Wirtschaft. Wie Schule und Bildung darauf reagieren sollen, könnte zum Beispiel in wissenschaftlich begleiteten Modellprojekten ausgelotet werden. Doch Calliope geht in eine andere Richtung. Konzerne schaffen Fakten in Form von Geschenken, die Politik hechelt dankbar hinterher. Kritische Nachfragen oder politischer Gestaltungswille sind da unerwünscht. Das erinnert an den aktuellen FDP-Slogan „Digital first, Bedenken second“. Dabei müsste gerade in der Bildung das Primat der Politik wieder hergestellt werden. In die Debatte um die Digitalisierung der Bildung hat sich eine Verselbstständigung eingeschlichen. Dabei sagt selbst eine Informatik-Professorin: „Es gibt keine Zwangsläufigkeit, jedem Trend und jeder technischen Errungenschaft hinterherzulaufen.“ Am Anfang der Überlegungen muss stehen, was SchülerInnen eigentlich lernen müssen, um aktuellen und künftigen Herausforderungen wie der Digitalisierung zu begegnen.
Digitalisierung als Einfallstor für Unternehmenseinfluss an Schulen
Digitalkonzerne haben die Bildung längst als wichtiges Spielfeld entdeckt. Und der Markt wird immer lukrativer. So will allein der Bund über den Digitalpakt in den nächsten Jahren fünf Milliarden Euro in die technische Infrastruktur der Schulen investieren. Das bringt die großen Akteure mitsamt ihren Stiftungen auf den Plan. Insbesondere Google versucht mit einer groß angelegten Lobbykampagne an Deutschlands Schulen Fuß zu fassen. So hat der Internet-Gigant mit der „Zukunftswerkstatt“ im Jahr 2017 ein Programm gestartet, dass Google-VR-Brillen an Schulen bringen soll und LehrerInnenfortbildungen anbietet. In den USA spricht man bereits von der „Googleifizierung“ der Bildung. Schließlich hat der Konzern dort den Markt für digitale Technik an Schulen bereits in fester Hand. Dank großzügiger Rabatte für Chromebooks und die kostenlose Abgabe der Office-Lösung G-Suite konnte Google seinen Marktanteil bei Computerneukäufen in Schulen von einem Prozent auf 58 Prozent seit 2012 steigern. Ein weiterer Akteur ist die Telekom-Stiftung, die derzeit in die Lehrerausbildung eingreift und dort Projekte finanziert. Schon knapp 20 Millionen Euro hat die Stiftung dafür seit ihrer Gründung 2003 ausgegeben, neue Investitionen sind angekündigt.
Besorgniserregend ist für uns auch die Äußerung von der mecklenburg-vorpommerischen Bildungsministerin Hesse, Schulsponsoring und die stärkere Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft seien ein „Modell der Zukunft“. Grundsätzliche Überlegungen zur Digitalisierung, auch in der Bildung, müssen gesellschaftlich diskutiert und politisch entschieden werden. Digitalisierung und deren Ausgestaltung, als eines der zentralen Zukunftsthemen, darf nicht den Konzernen überlassen werden.
Bleiben Sie informiert über Lobbyismus.
Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.
Datenschutzhinweis: Wir verarbeiten Ihre Daten auf der Grundlage der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Art. 6 Abs. 1). Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Zur Datenschutzerklärung.